Ich spreche gern von «Indie-Christen». Uwe Habenicht nennt diese Art von Religiosität «Freestyle Religion». Er subsummiert darunter freiere Formen von Religiosität, die er aktuell beobachtet, die individuelle Aneignung von Tradition(en).
In seinem gleichnamigen Buch zeigt er, wie diese Aneignung aussieht (und nennt dabei sowohl Chancen als auch Gefahren). Er entwirft ein Modell, das mir auch für Kirchenentwicklung brauchbar erscheint, weil es zeigt, auf welche Bedürfnisse von «Freestyle Religion» Kirche reagieren kann, um Menschen in ihrer Sinnsuche und -findung zu stärken.
Habenicht ist evangelisch-reformierter Pfarrer mit Schwerpunkt Jugendarbeit in St. Gallen (Schweiz). Schon in seinem ersten Buch «Leben mit leichtem Gepäck: Eine minimalistische Spiritualität» (Echter, 2018) fragte er nach der Zukunft des christlichen Glaubens. Wenn ich es richtig sehe (das Buch liegt halb gelesen auf meinem Schreibtisch), geht es dort eher um die individuelle Spiritualität, während er in «Freestyle Religion» die Chancen von gemeinschaftlichem religiösen Leben in der Gegenwart in den Fokus nimmt.
Nicht Säkularisierung, sondern Individualisierung
Die Situation sieht niederschmetternd aus: Religion in Westeuropa im Allgemeinen und das Christentum im Besonderen haben es versäumt, fluide mit den gesellschaftlichen Entwicklungen mitzugehen. So verabschiedet sich nicht nur die breite Masse stetig von den institutionalisierten Kirchen, auch der innere Kern schrumpft. Habenicht erstellt eine eingehende Zeitanalyse, in der er zwar u.a. «Entkirchlichung» und «Enttraditionalisierung» diagnostiziert, aber auch ein grosses Bedürfnis nach spiritueller Kompetenz: Die/der Einzelne stehe heute mehr denn je vor der Herausforderung, sich ihre/seine Religion selber zusammenzustellen.
Was nach Freiheit klingen mag, konstatiert er als Zwang. Elemente der Spiritualität, die früher alle durch die eine Kirche abgedeckt wurden (Riten, Moral, Kollektividentität, subjektiver Glaube etc.), würden heute an diversen Orten und pluralistisch angeboten. Die heutige Zeit sei religiös nicht primär von Säkularisierung gekennzeichnet, sondern von Individualisierung.
Aspekte zeitgenössischer Religiosität
Habenicht entwirft ein Modell, wie eine solche selbstgewählte Spiritualität aussehen muss, damit sie gesund, lebensdienlich und auch nächstenliebend wird. Dass er mit diversen Unterscheidungen/Gegensätzen und Kriterien/Kategorien operiert und sich an verschiedenen bestehenden Konzepten orientiert, macht es etwas verwirrend.
Den Konzepten, die Habenicht als Referenzen hinzuzieht, ist gemeinsam, dass sie auf Beziehungen fokussieren, etwa der Resonanzbegriff von Hartmut Rosa. Spiritualität kann nicht nur individuell sein – sie muss andere Menschen, die Welt als solche sowie das Heilige einbeziehen. Menschen haben das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Partizipation. Und so spricht eine ausgewogene, gelingende Spiritualität sowohl den individuellen Raum, die Gemeinschaft und die globale Realität an, als auch eine transzendente Beziehungsebene.
Grob gesagt beinhaltet Habenichts Modell einer zeitgenössischen Religiosität drei Aspekte:
- den liturgisch-kultischen
- den individuell-kontemplativen
- den ethisch-weltzugewandten
Der liturgisch-kultische Aspekt stärkt die beiden anderen Aspekte gleichermassen, wie er aber auch aus ihnen schöpft. Alle drei beruhen auf einer Mischung aus aktivem Handeln und passivem Erleben/An-sich-handeln-lassen.
Ich nehme an dieser Stelle vorweg, dass Habenicht am Schluss des Buches bewährte und eigene Beispiele für kirchliche und individuelle Spiritualität nennt. Vieles scheint mir praktikabel: Strassenexerzitien etwa, Bibel lesen lernen, Herzensgebet etc. Seinen Enthusiasmus für «ungewöhnliche» kirchliche Aktivitäten wie «Marathonlesung der Psalmen, Speedreading der Evangelien» etc. teile ich hingegen weniger, da ich sie als PR-Projekte mit wenig Nachhaltigkeit empfinde.

Kirche als Kompetenzzentrum für Spiritualität
Autonomie ist das Leitwort des postmodernen Menschen. Kirche als gemeinschaftliche Institution scheint dem erst einmal entgegengestellt. Indem Uwe Habenicht aber die Bedürfnisse von sinnsuchenden, spirituellen Menschen nennt, wird auch deutlich, was Kirche (in verschiedenen Ausprägungen!) zu bieten hat: Tradition und Kompetenz, um Menschen in Beziehung mit dem Heiligen zu bringen. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass Habenicht über weite Strecken religions- und konfessionsneutral schreibt.
Heute muss diese Unterstützung bei der Sinnsuche durch die Kirche andere Kriterien erfüllen als früher: U.a. müssen religiöse Angebote zeitbegrenzt und voraussetzungslos sein. (Dazu verlinke ich gerne auch den Blogpost von Juhopma: «Warum ich ab heute im Netflix-Zeitalter arbeite».)
Empowerment durch geduldige Begleitpersonen
Einige der Aspekte von «Freestyle Religion», in welchen Kirche Menschen stärken kann, fasse ich in eigenen Worten zusammen: (Und wenn ich «Kirche» schreibe, meine ich einerseits die institutionalisierte Kirche, aber auch einzelne Player und fluide Gruppen in der «Gemeinschaft der Gläubigen», vgl. «Lagerfeuer».)
- Empowerment: Kirche kann Menschen in ihrer religiösen Autonomie fördern. Also anregen, selber zu reflektieren, statt bloss Wissen zu transferieren.
- Narrativ: Das Christentum bietet eine Erzählung des Grossen Ganzen, in dem die/der Einzelne verorten kann. Kirche kann Menschen darin stärken, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Dadurch können sie sowohl zu einer gesunden, empowerten, integrierten Identität als auch zu einem Gefühl der Zugehörigkeit finden. Kirchliche Gemeinschaft kann aber auch ein Ort sein, wo Menschen mit zerrissenen Geschichten erst einmal einfach ankommen können.
- Sprachfähigkeit: Zum Erzählen der eigenen Geschichte gehört auch, sprachfähig zu werden. Für die Beziehung mit dem Heiligen fehlt diese Sprache v.a. bei nicht kirchlich sozialisierten Menschen. Aber auch «Fromme» sollten die eigene Tradition so reflektieren, dass sie nicht nur Floskeln repetieren, sondern lebensnah und (selbst-)verständlich über den eigenen Glauben sprechen können.
- Erfahrungen von Präsenz: Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sowie zum Grossen Ganzen. Hier spielen auch körperbezogene Erfahrungen wie Pilgern, Singen etc. eine Rolle.
- Kooperation: Autonom kann sich die/der Einzelne dazu entschliessen, mit anderen in Gemeinschaft zu treten. So können sie auch zum Wohl von anderen kooperieren. Viele Kirchen sind kompetente Plattformen für diakonische und soziale Aktivitäten. Doch bieten sich hier auch interreligiöse Anknüpfungspunkte.
In Bezug auf kirchliches «Personal» und damit auch meine eigene Tätigkeit gefällt mir ein Satz von Uwe Habenicht besonders: «So sind für die Zukunft weniger spirituelle Gurus als vielmehr geduldige Begleiter[*innen] gesucht, die diese Such- und Übungsphasen kritisch und liebevoll begleiten.»
Fazit
Leider wirkt das Cover etwas altbacken und anbiedernd, doch «Freestyle Religion» bietet auf angenehm wenigen Seiten eine dichte Gegenwartsanalyse und gute Impulse. Angesichts meiner eigenen Auseinandersetzung mit neuen Formen von Kirche und Gemeinschaft fand ich in einen inspirierenden Dialog mit diesem Buch. Das Modell, welches Habenicht entwirft, empfinde ich als sinnvoll und realistisch.
Uwe Habenicht: «Freestyle Religion. Eigensinnig, kooperativ und weltzugewandt – eine Spiritualität für das 21. Jahrhundert» Echter Verlag, 2020


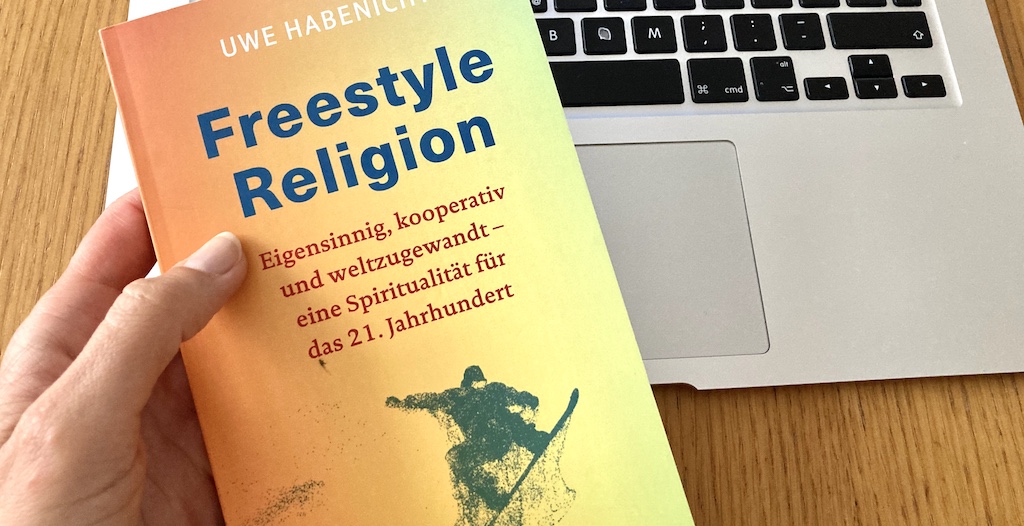
Sehr interessant! Ob Sie auch einmal eine Rezension des Buches «Das Religionsparadox» von Victoria Rationi schreiben könnten? Ihre provokante These (die sie mit weltweiten Statistiken belegt!): je weniger religiöse Menschen es in einem Land gibt, desto friedlicher ist es.
MfG Hannelore